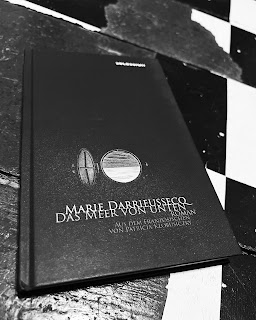„Der Diskurs über Ostdeutschland ist kompliziert und dreht sich im Kreis.“ (Seite 7)
Kommen wir also mal wieder zurück auf den Osten. Bücher zu und über Ostdeutschland tauchen an dieser Stelle ja oft genug auf. Und da die Debatte darüber, was den Osten denn nun beschreibe oder auszeichne, ohnehin mit schöner Regelmäßigkeit aufflammt, muss ich auch kein schlechtes Gewissen wegen Redundanz haben. 😊
Und gern räume ich das Offensichtliche ein, nämlich dass es Stimmen in der Debatte gibt, die mich eher erreichen als andere. Und Steffen Maus Stimme gehört zu eben denen. Was ich an seinen Texten schätze, ist dass sie im Vergleich so viel unaufgeregter daherkommen und schon allein dadurch argumentativ für meinen Geschmack sehr viel stärker wirken (können).
Insofern passt es ganz gut, dass ich eines der Bücher kurz zuvor gelesen hatte, auf das sich auch Mau in diesem schmalen Band bezieht, nämlich Dirk Oschmanns Text über die vermeintlich westdeutsche Erfindung des Ostens. Dass mich dieser Text so gar nicht erreichte, hatte ich hier ja schon berichtet.
Mau dagegen wägt die wechselseitig vorherrschenden Vorurteile gegeneinander ab und stellt eines, wie ich finde, sehr gut heraus: Der Transformationsprozess ist westdeutsch dominiert vorangetrieben worden. Es ist aber mitnichten so, dass die „Ossis“ in dieser Phase ausschließlich passives Objekt gewesen seien. Denn natürlich gestalteten die Menschen im Land auch in dieser Zeit ihr Leben, versuchten zurechtzukommen, fanden Wege – individuell mal erfolgreicher, mal weniger – und prägten eben diese Menschen auch ihr Zusammenleben vor Ort. Geschichten darüber, wie alles kam und vor sich geht, konstituierten sich und prägten und prägen die Wahrnehmung und auch das Handeln der nachgeborenen Generationen.
Das mag dann auch eine Teilerklärung dafür sein, was mir auch immer wieder auffällt, dass jüngere ohne direkten biografischen Bezug zur DDR oft eine sehr viel ausgeprägtere Ostidentität an den Tag legen, als ich das zum Beispiel bei mir selbst (Jahrgang 1975) oder meiner Generation so wahrnehme.
Als einen markanten Unterschied, der sich auch nicht angleichen oder „aufholen“ lässt, stellt Mau heraus, dass es in der DDR nun mal keine mit „1968“ vergleichbare Erfahrung gibt. Bei den tiefgreifenden und bleibenden Prägungen, die diese Generationserfahrung in der alten Bundesrepublik hinterließ, ist unbezweifelbar, dass es Ähnliches im Osten nun nicht gab und geben konnte.
Mir erscheint dieser Punkt gerade für das (Selbst-)Verständnis von Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Funktionieren sehr wesentlich zu sein. Einerseits mischen sich natürlich auch im Osten Menschen in ihre Belange vor Ort ein, arbeiten in Vereinen, veranstalten Feste etc. Aber zugleich lässt sich sicher ein gewisser Abstand zu institutionellen Einrichtungen feststellen. Kommunale, Strukturen von Staatlichkeit sind zwar da, aber werden oft sicher nicht als die Garanten von langfristiger Sicherheit wahrgenommen.
Ähnliches mag für die bundesrepublikanische Parteiendemokratie gelten, die vielen nach wie vor als eher übergestülpt gilt, egal wie viele Menschen von vor Ort sich da engagieren oder auch nicht. Folgerichtig plädiert Mau schließlich dafür, im Osten gezielt andere, neue Beteiligungsformen auszuprobieren, um das Vertrauen in gesellschaftliche und staatliche Strukturen aufzubauen, zu stärken.
Im Kern kommt Mau zu dem Ergebnis, dass die Unterschiede zwischen Ost und West sich weiter halten werden, weil sich hier zwei nicht deckungsgleiche Entwicklungspfade beschritten werden. Es erscheint mir auch sehr kurz gesprungen anzunehmen, dass wenn es den Leuten finanziell nur gut genug gehe, sie das Gleich konsumieren können, daraus folgen müsste, dass dann alles wird wie im Westen. Wie sollte es das, wenn auf dem Weg zum Heute zum Teil so deutlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden.
Vielleicht müsste die Frage ja dann nicht mehr lauten, warum die „Ossis“ so anders seien, sondern eher: Was eint dieses größere Deutschland, was verbindet die Menschen und lässt sie sich einander zugehörig empfinden? Und vielleicht sollten alle Demokrat:innen sich zügig daran machen hier Antworten zu finden, bevor es die Populisten von #noafd und BSW schaffen als Einzige zu den Menschen durchzudringen und ihre spaltenden Diskurse weiter zu vertiefen.
Kurz und gut: Muss man kein Ossi für sein. Lesen, unbedingt!
#lesewinter #sachbuch #steffenmau #suhrkamp #ostdeutschland #deutschland #identität #debatte #gesellschaft #politik #soziologie #polbil #lesen #leselust #lesenswert #leseratte #bücher